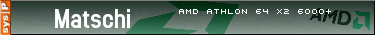Die Erfolgsraten des Zellkerntransfers bei Tieren sind gering. So wurden, um Dolly zu erzeugen, 277 Eizellen verbraucht. Üblicherweise sterben 60 bis 90 % der fusionierten Eizellen, bevor sie eingepflanzt werden können. Inzwischen sind die Ausbeuten verbessert und Klone von Mäusen, Ziegen, Schweinen, Katzen, Maultieren, Pferden, Ratten, Kaninchen, Hunden und Fliegen erzeugt worden. Das Klonen von Primaten gestaltet sich schwieriger, bislang ging eine Schwangerschaft noch nicht über den ersten Monat hinaus. Auch bei anderen Tieren sind die Überlebenschancen für erfolgreich implantierte geklonte Embryonen gering, die Zahl der Fehl- und Missgeburten sowie die Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen sehr hoch. Darüber hinaus treten Nebenwirkungen wie ein geschwächtes Immunsystem, Fehlbildungen von Organen, Arthritis und Fettsucht auf.
Als eine der Ursachen wird die unvollständige oder fehlerhafte Reprogrammierung des Erbmaterials vermutet. Bei der Entwicklung eines durch normale Befruchtung erzeugten Embryos werden bestimmte Gene nur abgelesen, wenn sie von der Mutter stammen, andere nur, wenn sie väterlichen Ursprungs sind (Imprinting). Beim Klonen fehlt die Vermischung von mütterlichem und väterlichem Erbmaterial jedoch. Ein anderes Problem besteht insbesondere darin, dass das Erbgut beim Zellkerntransfer von einem erwachsenen Spender stammt. Aufgrund der gealterten DNA geht man von einer allgemein niedrigeren Lebenserwartung beziehungsweise von vorzeitiger Alterung sowie von einer erhöhten Tumorneigung des Klons aus.
Unklar ist, welche Folgen das Verbleiben der Mitochondrien in der Eizelle nach dem Entkernen hat. Die Mitochondrien, Orte der Energieerzeugung in der Zelle, enthalten eine geringe Menge eigener DNA, die eventuell nicht mit der Fremd-DNA kompatibel ist.
Was sind denn das für merkwürdige Beispiele, die rein gar nichts mit der Sache zu tun haben?




 Zitieren
Zitieren